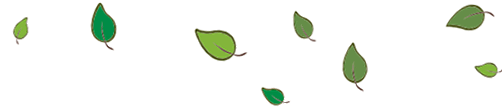|
Im NiemandslandInklusive Gemeinden – nur ein Traum? Sonntagmorgen am Frühstückstisch. Es wird Zeit für den Gottesdienstbesuch. Wieder einmal steht die Frage im Raum: Wer geht heute hin und wer bleibt zu Hause? Eine Frage, die vor ein paar Jahren noch kein Thema für uns war. Selbstverständlich gehörte zum Sonntag auch der gemeinsame Gottesdienstbesuch. Es gab zwar immer mal wieder Diskussionen darüber, ob die Lieder nicht zu altmodisch, die Form zu liturgisch oder die Predigt zu weltfremd sei. Aber wir kamen trotzdem regelmäßig in den Gottesdienst und brachten uns mit unseren Gaben ein. Seit sieben Jahren hat sich bei uns ein schleichender Wandel vollzogen, der unmittelbar mit der Geburt unseres zweiten Kindes zusammenhängt. Niklas hat unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Er hat eine Autismus-Spektrum-Störung, die sich auf Verhalten und soziale Interaktion mit anderen Menschen auswirkt. Plötzlich ist nichts mehr selbstverständlich – auch nicht der Gottesdienstbesuch. Denn bei einem Gottesdienst, wie wir ihn gewohnt sind, gibt es nun mal unausgesprochene Regeln und Normen, an die man sich halten muss. Wer sich da nicht anpassen kann, fällt aus dem Rahmen und ist in Gefahr, ausgegrenzt zu werden. Menschen, die nicht still sitzen können, die beim „Stillen Gebet“ reinquatschen, die im falschen Moment singen oder gerne fremde Menschen umarmen, werden schnell schräg angeschaut. Bei Eltern von Kindern, die sich auffällig verhalten, wird auch gerne die Erziehungskompetenz in Frage gestellt. Klar, dass man sich das auf Dauer nicht freiwillig antut. Was ist die Konsequenz? Man geht entweder gar nicht mehr in den Gottesdienst oder man teilt sich auf: Ein Elternteil geht mit dem nichtbehinderten Kind in die Kirche, während der andere sich zusammen mit dem behinderten Kind den Fernsehgottesdienst ansieht. Aber sieht so christliche Gemeinschaft aus? Sonder-Behandlung
Die Antwort auf dieses Thema sind Sondereinrichtungen für die, die nicht in die vorgesehenen Schubladen passen. Diese Kindergärten, Schulen, Werkstätten, Heime aber auch Freizeitclubs werden noch mit pädagogisch wohlklingenden Etiketten versehen, die mit „Förder-“ oder „Sonder-“ oder „Beschützte“ anfangen. Und dort tummeln sich dann alle, die einen „be-sonderen“ Förderbedarf haben, werden von speziell ausgebildetem Personal betreut und haben sich dort auch entsprechend wohlzufühlen. Aber was ist, wenn diese „Sonder-Behandlung“ gar nicht ihren Bedürfnissen entspricht? Was ist mit dem urmenschlichen Bedürfnis, einfach nur dazuzugehören? Ein Platz in der Gemeinschaft Das Recht auf Teilhabe ist in der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen verankert. Bereits vor gut zwei Jahren wurde sie von Deutschland unterzeichnet. Österreich hat die Konvention ebenfalls ratifiziert, die Schweiz bisher noch nicht. Und unsere christlichen Gemeinden? Offensichtlich haben viele noch nicht verstanden, dass „Inklusion“ dem christlichen Menschenbild zutiefst entspricht. In der Theorie ist uns zwar klar, dass Gott uns ohne Ansehen der Person liebt. Dass er nicht nach arm oder reich, krank oder gesund, behindert oder nichtbehindert sortiert. Aber in der Praxis sortieren wir fleißig und grenzen aus, was nicht den Kriterien entspricht, die wir festgelegt haben. Spontan singen und tanzen Manchmal frage ich mich, ob wir Jesus wirklich verstanden haben, wenn wir die Bibel lesen. Ich stelle mir vor, Jesus hätte so gehandelt, wie wir es oft tun. Dann hätte er bei seiner Bergpredigt wohl erst mal alle Eltern mit kleinen Kindern nach hinten geschickt, weil man ihn ja sonst nicht verstanden hätte. Oder er hätte den Müttern, die ihre Kinder zu ihm bringen wollten, damit er sie segnet, erst mal ordentlich die Leviten gelesen, weil ihre Kinder nicht artig in einer Reihe standen oder ihre Rotznasen an seinem Gewand abputzten. Er hätte dem blinden Bartimäus ein großzügiges Almosen gegeben und ein paar seiner sozial eingestellten Jünger damit beauftragt, sich mal um ihn zu kümmern. Und Zachäus hätte er auf seinem Baum sitzen lassen. Aber Jesus hat seine Zuhörer und uns, die wir diese Geschichten lesen, immer wieder überrascht mit seinem provokanten Verhalten und seinen herausfordernden Aussagen. Wie würden die Gottesdienste heute aussehen, wenn Jesus sie gestalten würde? Ich stelle mir vor, wie er mit unserem Sohn und den anderen Kindern spontan singen und dazu tanzen würde. Seine Predigt wäre einfach und mit vielen Alltagsgeschichten gespickt, sodass auch der pubertäre Jugendliche aus der Förderschule mitkommt. Und mit denen, die sich eine theologisch tiefgründige Exegese wünschen, diskutiert er nach dem Gottesdienst weiter. Vielleicht auch am gemeinsamen Mittagstisch, an dem selbstverständlich jeder willkommen ist. Und wahrscheinlich hätte er es auch heute wieder schwer mit denen, die darauf bestehen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil Veränderung auch Verunsicherung mit sich bringen kann. Dass unsere Gemeinden „inklusiv“ werden, offen für Begegnung mit denen, die anders sind, Barrieren in Kopf und Herz überwinden, sich von Gottes Geist aufeinander zu bewegen lassen – das ist meine Vision. Sie beinhaltet die einmalige Chance, zu der Gemeinschaft zu werden, wie Gott sie sich gedacht hat. Die Autorin möchte anonym bleiben. www.family.de |







 In uns macht sich so etwas wie Resignation breit. Wir spüren, dass es in unseren Gemeinden auch nicht anders zugeht als in unserer Gesellschaft. Es wird sortiert, bewertet und ausgegrenzt, was nicht ins System passt. Angefangen von Kindergarten und Schule über Freizeitaktivitäten bis zum Berufsleben. Überall sind da die vorgefertigten Schubladen, in die wir hineinpassen müssen. Aus Gottes geliebten Originalen werden „behinderte oder therapiebedürftige Problem- oder Sorgenkinder“. Ihre liebenswürdigen Seiten und besonderen Stärken werden dabei meist übersehen, weil sie nicht den gängigen Leistungskriterien und -maßstäben entsprechen.
In uns macht sich so etwas wie Resignation breit. Wir spüren, dass es in unseren Gemeinden auch nicht anders zugeht als in unserer Gesellschaft. Es wird sortiert, bewertet und ausgegrenzt, was nicht ins System passt. Angefangen von Kindergarten und Schule über Freizeitaktivitäten bis zum Berufsleben. Überall sind da die vorgefertigten Schubladen, in die wir hineinpassen müssen. Aus Gottes geliebten Originalen werden „behinderte oder therapiebedürftige Problem- oder Sorgenkinder“. Ihre liebenswürdigen Seiten und besonderen Stärken werden dabei meist übersehen, weil sie nicht den gängigen Leistungskriterien und -maßstäben entsprechen.